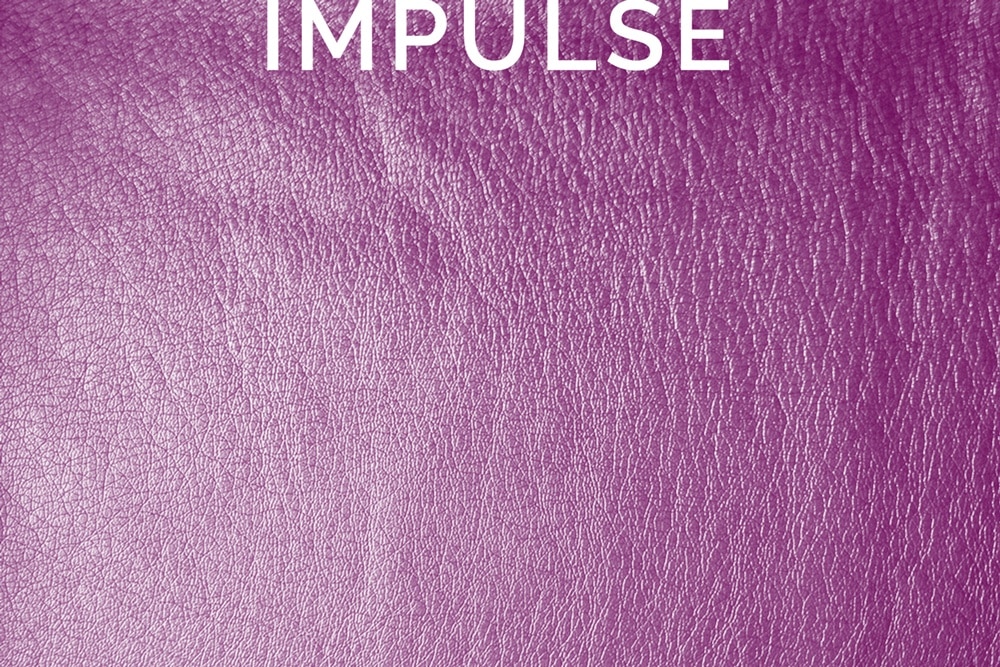Vielleicht trennt uns Menschen weniger, als es manchmal den Anschein hat
In diesem Impuls ging es darum, wie unser Gehirn die Welt wahrnimmt und warum Bedrohliches neurobiologisch viel leichter verarbeitet wird als Positives. Diese Verzerrung zeigt sich nicht nur in unserem Blick auf die Welt, sondern auch in unserem Miteinander.
Wir sortieren Menschen blitzschnell in Schubladen: Jung oder alt, Stadt oder Land, vertraut oder fremd. Das Gehirn kategorisiert automatisch, oft bevor wir bewusst darüber nachdenken.
Warum unser Gehirn Unterschiede schneller erkennt
Neurobiologisch ist das gut erklärbar. Das Gehirn ist darauf ausgelegt, Unterschiede zu erkennen, weil sie die Orientierungs- und Risikoverarbeitung aktivieren. Abweichungen signalisieren: Hier könnte etwas sein, das potenziell bedrohlich ist und damit unsere Aufmerksamkeit erfordert.
Gemeinsamkeit hingegen bleibt im Hintergrund. Sie ist neurobiologisch „leiser“, weil sie keine unmittelbare Handlung auslöst. Das System registriert sie, aber sie drängt sich nicht in den Vordergrund.
Das bedeutet: Wir übersehen Gemeinsamkeit nicht aus Absicht, sondern weil unser Gehirn anders priorisiert.
Ein Video, das mich berührt
Es gibt ein Video, das mir vor Jahren begegnet ist und das mich noch heute berührt, wenn ich es sehe.
Der dänische Sender TV2 hat es vor einigen Jahren im Rahmen einer gesellschaftlichen Kampagne produziert. In nur drei Minuten gelingt es auf eine sehr menschliche – und manchmal auch unerwartete – Weise zu zeigen, wie viel uns verbindet, wenn wir genauer hinsehen.
Ich möchte dir nicht zu viel verraten. Schau es dir an – es lohnt sich.
👉 All That We Share – TV2 Denmark (bei Youtube)
Wenn Gemeinsamkeit sichtbar wird, entsteht Verbundenheit
Das Video zeigt nicht nur Gemeinsamkeit. Es zeigt vor allem was passiert, wenn wir sie wahrnehmen.
Verbundenheit ist kein abstraktes Konzept. Sie ist ein Gefühl, das neurobiologisch messbar ist. Wenn wir Gemeinsamkeit wahrnehmen, aktiviert sich das soziale Sicherheitssystem im Gehirn. Oxytocin wird ausgeschüttet, der Vagusnerv signalisiert dem Körper: Hier ist Sicherheit.
Verbundenheit beruhigt. Sie gibt das Gefühl: „Ich bin nicht allein.“
Was das mit Resilienz zu tun hat
Verbundenheit ist einer der stärksten neurobiologischen Schutzfaktoren, die wir haben.
Sie wirkt Isolation entgegen. Sie gibt Halt, wenn das eigene System unter Druck steht. Sie erinnert uns daran, dass wir Teil von etwas Größerem sind, auch wenn wir uns manchmal getrennt fühlen.
Wir sind darauf ausgelegt, in Gemeinschaft eingebettet zu sein. Wenn diese Verbindung spürbar wird, stabilisiert das unser gesamtes inneres System.
Verbundenheit braucht keine großen Gesten. Oft entsteht sie in stillen Momenten: einem Blick, einem geteilten Gedanken, der Erkenntnis, dass jemand anderes genauso fühlt wie ich.
Vielleicht gibt es mehr Gemeinsamkeit, als wir sehen
Ich schreibe das nicht, um Unterschiede zu leugnen. Sie existieren – und sie dürfen existieren.
Unterschiede können irritieren, herausfordern und manchmal auch trennen.
Aber sie können auch zeigen, wo wir voneinander lernen können.
Sie erweitern Perspektiven, die uns allein nicht zugänglich wären.
Sie erinnern daran, dass Vielfalt nicht das Problem ist, sondern die Art, wie wir damit umgehen.
Das Gehirn registriert Unterschiede als Orientierungspunkte. Das ist nicht falsch sondern es hilft uns, uns in der Welt zurechtzufinden.
Das Problem entsteht erst, wenn Unterschiede automatisch als Bedrohung interpretiert werden, statt als Information.
Es geht also nicht darum, Unterschiede zu ignorieren. Es geht darum, bewusst zu entscheiden: Werden Unterschiede zur Barriere oder zum Anlass, den anderen besser verstehen zu wollen?

ResilienzImpulse
Lust auf Persönlichkeitsentwicklung mit Herz und wissenschaftlicher Grundlage? Dann bist du bei meinen beliebten ResilienzImpulsen genau richtig!

Marion Wandke
Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie Menschen in komplexen Lebensphasen innerlich klar und handlungsfähig bleiben können. Mich interessieren besonders die Wechselwirkungen zwischen Denken, Fühlen und Körperwahrnehmung – dort, wo Selbstregulation gefordert ist.
Ich arbeite heute als Resilienz-Coachin mit Fokus auf humanistischer Psychologie und Psychotherapie, Neurowissenschaften und Embodiment. Mein Schwerpunkt liegt auf Selbstführung und Selbstregulation als Schlüsselkompetenz. Ich bin überzeugt, dass echte innere Stärke aus Klarheit, Werteorientierung und Selbstführung entsteht.