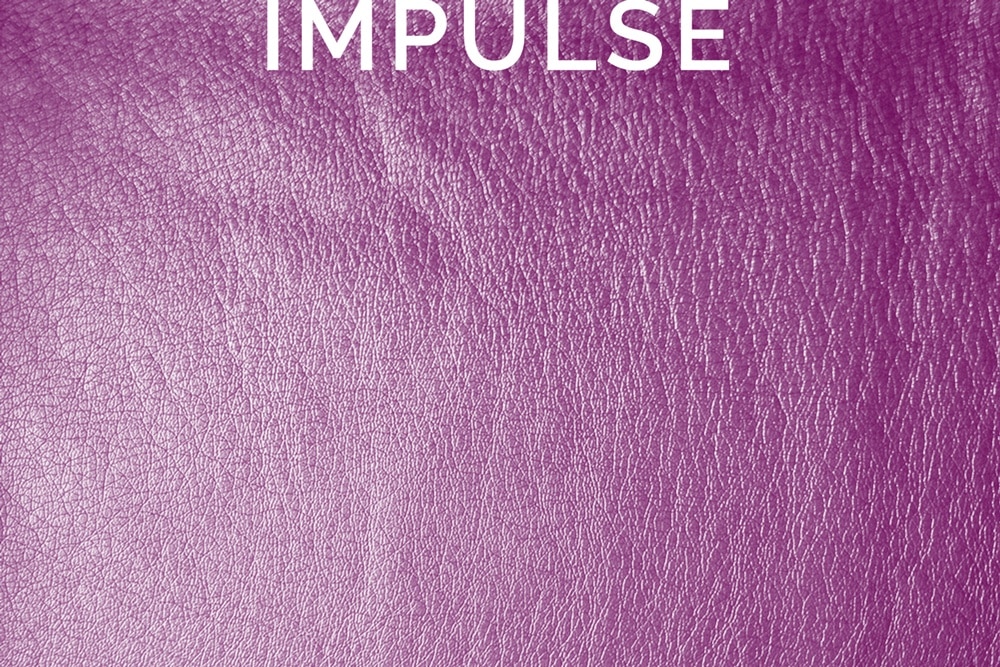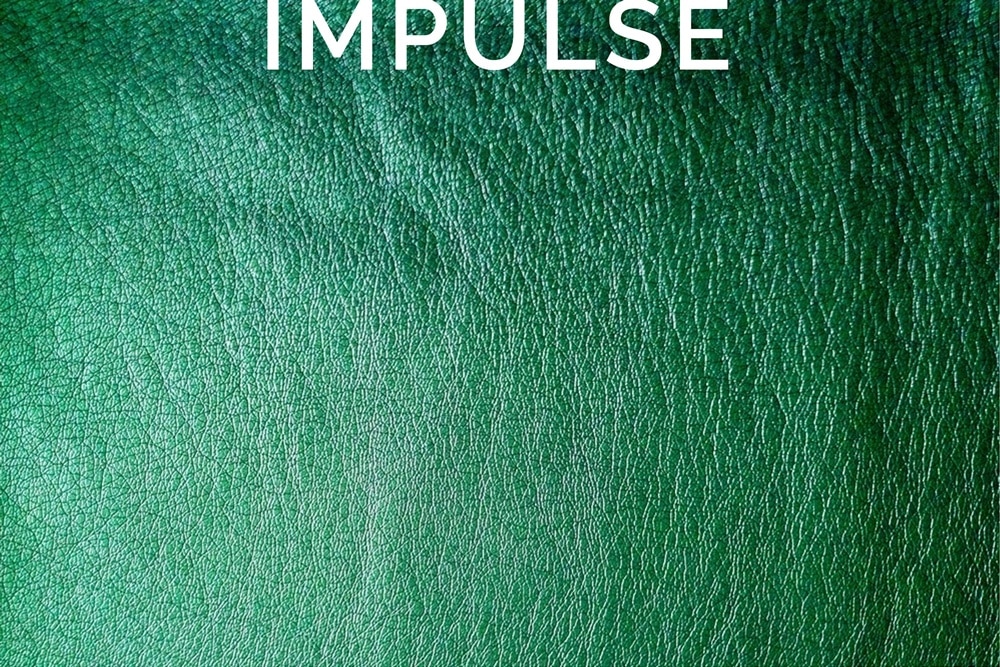Innere Unruhe verstehen –
wenn Körper und Geist nicht zur Ruhe kommen
Warum innere Unruhe so viele Gesichter hat
Innere Unruhe ist kein eindeutiges Gefühl. Sie kann sich zeigen als Spannung im Körper, als rastloses Denken, als Überreizung oder als ein diffuses Gefühl von Getrenntsein. Manche spüren sie als Druck in der Brust, andere als Getriebenheit im Kopf oder als seltsame innere Leere.
Gemeinsam ist all diesen Formen: Das Nervensystem hat seine Balance verloren. Es ist aktiv, obwohl es gerade keinen Anlass dazu gibt.
Dabei ist Unruhe nicht per se „schlecht“. Kurzzeitig mobilisiert sie Energie – der Körper bereitet sich auf Aktivität vor. Wird dieser Zustand jedoch chronisch, verliert das Nervensystem seine Flexibilität.
Dann bleibt der Körper im Modus der Anspannung, auch wenn keine reale Herausforderung mehr besteht.
Psychologisch lässt sich innere Unruhe als ein Zustand beschreiben, in dem sich das Nervensystem zwischen Aktivierung und Erschöpfung aufreibt. Sie entsteht, wenn innere oder äußere Reize nicht mehr vollständig verarbeitet werden können.
Neurobiologisch betrachtet ist Unruhe eine Schutzreaktion, die nicht vollständig beendet wurde. Der Körper bleibt in Bereitschaft, weil er Sicherheit noch nicht eindeutig wahrnimmt.
Wie sich das anfühlt, hängt davon ab, an welcher Stelle im System die Aktivierung hängen bleibt – ob im Körper, im Denken, in den Sinnen oder in der Selbstwahrnehmung.
Diese vier Ausdrucksformen bilden die Grundlage, um innere Unruhe besser zu verstehen. In diesem Artikel erfährst du, was in deinem Nervensystem geschieht, warum sich Unruhe so unterschiedlich zeigen kann und wie du erkennst, was dein System gerade braucht.

Beruhige dein Nervensystem
E-Book für 0 €

Wenn dein Körper unter Hochspannung steht
Körperliche Anspannung ist oft das erste Anzeichen innerer Unruhe. Der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung wird flach, Muskeln ziehen sich zusammen. Auch wenn die Situation längst vorbei ist, bleibt der Körper in Alarmbereitschaft. Dieses Nachlaufen ist ein biologischer Mechanismus: Das Nervensystem braucht Zeit, um zu erkennen, dass keine Gefahr mehr besteht.
Anhaltende Hochspannung entsteht, wenn der Körper im „Bereitschaftsmodus“ stecken bleibt. Der Sympathikus – der Teil des Nervensystems, der dich aktiv und leistungsfähig hält – arbeitet weiter, obwohl der Parasympathikus, zuständig für Erholung, längst übernehmen sollte. Dieses Ungleichgewicht kann sich in Unruhe, Schlafproblemen oder Erschöpfung zeigen.
Das ist, als würde man gleichzeitig Gas geben und auf der Bremse stehen.
Der Weg zurück in die Regulation führt deshalb über den Körper selbst. Erst wenn er eindeutige Signale von Sicherheit erhält – durch Atmung, Bewegung, Kälte oder Berührung – kann er das Stressprogramm beenden. Dann schaltet das System wieder auf Ruhe, und aus der Anspannung wird allmählich Entlastung.
Was du spüren kannst
All das sind Zeichen, dass dein Körper unter Spannung steht und Energie mobilisiert.
Was im Nervensystem passiert
In diesen Momenten ist dein Sympathikus aktiv – der Teil des autonomen Nervensystems, der dich auf Leistung und Schutz vorbereitet. Er setzt Stresshormone frei, erhöht Puls und Muskelspannung und sorgt dafür, dass du schnell reagieren kannst. Das ist eine normale Reaktion, wenn dein Gehirn eine Situation als potenziell bedrohlich bewertet.
Bleibt dieser Zustand jedoch bestehen, ohne dass reale Gefahr vorhanden ist, kann der Körper nicht mehr von selbst in den Ruhemodus zurückkehren. Dann entsteht die typische innere Hochspannung, die sich als Unruhe, Gereiztheit oder Erschöpfung zeigt.
Wie du reagieren kannst
Der Weg zurück in die Regulation führt über den Körper.
Gezielte körperliche Reize – wie Kälte, Bewegung oder bewusste Atmung – aktivieren den Parasympathikus, also den Teil des Nervensystems, der für Entspannung und Regeneration zuständig ist.
So sendest du deinem Gehirn ein klares Signal: Es ist sicher.
👉 Passende Tools findest du im kostenlosen E-Book „Notfallkoffer bei innerer Unruhe“
Wenn es in deinem Kopf zu laut ist
Manchmal zeigt sich Unruhe weniger im Körper als im Denken. Gedanken drehen sich im Kreis, To-do-Listen laufen endlos weiter, selbst im Bett bleibt der Kopf aktiv. Dieses Grübeln erzeugt ein ständiges „Mentales Rauschen“, das das Gehirn permanent aktiv hält. Das Nervensystem reagiert entsprechend.
Dazu kommt die permanente Reizüberflutung unserer Zeit. Das Gehirn bekommt kaum noch Leerlauf. Zwischen E-Mails, Benachrichtigungen und ständiger Erreichbarkeit entsteht ein Zustand chronischer Wachheit, der auch den Körper im Aktivierungsmodus hält.
Innere Ruhe braucht also nicht nur Pausen, sondern auch mentale Räume, in denen keine neuen Reize ankommen.
Was du spüren kannst
All das sind Zeichen, dass dein Körper unter Spannung steht und Energie mobilisiert.
Was im Nervensystem passiert
Bei anhaltendem Grübeln ist das Arbeitsgedächtnis überlastet. Das Gehirn versucht, unvollendete Aufgaben oder ungelöste Fragen „offen“ zu halten.
Dadurch bleibt die Amygdala – das emotionale Alarmsystem – aktiv, selbst wenn keine reale Gefahr besteht.
Die Verbindung zum präfrontalen Kortex, der für Übersicht und Regulation zuständig ist, wird geschwächt.
Das Denken läuft dann im Kreis, während der Körper weiter im Stressmodus bleibt.
Wie du reagieren kannst
Der Ausweg liegt darin, dein Gehirn kurz zu „entlasten“.
Wenn du Gedanken aufschreibst, Emotionen benennst oder dich auf den Atem konzentrierst, aktivierst du wieder den präfrontalen Kortex – den Teil, der Überblick schafft.
Auch kurze Momente des Humors oder bewusste Selbstansprache helfen, Abstand zu gewinnen.
👉 Passende Tools findest du im kostenlosen E-Book „Notfallkoffer bei innerer Unruhe“
Wenn deine Sinne überlastet sind
Innere Unruhe zeigt sich nicht immer als sichtbare Anspannung oder Gedankenkreisen. Manchmal fühlt sie sich dumpfer an – wie ein Übermaß an Eindrücken oder wie eine tiefe Müdigkeit, die keine Erholung bringt. Der Kopf ist voll, der Körper leer, und trotzdem bleibt das Gefühl von Unruhe.
In solchen Momenten hat das Nervensystem seine Kapazitätsgrenze erreicht: zu viele Reize, zu viel Daueraktivität, zu wenig echte Regeneration. Körper und Sinne bleiben wach, obwohl du Ruhe brauchst.
Warum Erschöpfung und Überreizung zusammenhängen
Überreizung ist im Kern nichts anderes als eine Energieverschiebung. Der Körper hat zu lange auf Empfang gestanden – aufmerksam, leistungsbereit, wach. Wenn diese Phase zu lange anhält, ist die Energie verbraucht, aber die Aktivierung läuft weiter. Das System kann nicht zwischen „aktiv bleiben“ und „abschalten“ unterscheiden, weil beides als notwendig erlebt wird. Das erklärt, warum Erschöpfung und Unruhe so oft gemeinsam auftreten.
Was du spüren kannst
Das sind Zeichen, dass dein Nervensystem mit zu vielen Sinneseindrücken konfrontiert ist.
Was im Nervensystem passiert
Deine Sinneskanäle – besonders Sehen und Hören – sind direkt mit dem Thalamus verbunden, der als Filter für Reize dient.
Bei Reizüberflutung kann dieser Filter überfordert sein. Das Gehirn sortiert Informationen nicht mehr effizient, wodurch ein Gefühl innerer Unordnung entsteht.
Die Aktivität im visuellen und auditiven Kortex bleibt hoch, während der Körper kaum Erholungssignale erhält.
So entsteht das Empfinden, „überreizt“ oder „nicht mehr aufnahmefähig“ zu sein.
Wie du reagieren kannst
Der wichtigste Schritt ist Reizbegrenzung.
Reduziere Lärm, Licht oder visuelle Eindrücke und gib deinem Gehirn die Chance, die Informationsflut zu verarbeiten.
Auch Weitblick, frische Luft oder bewusster Kontakt mit einem vertrauten Duft können helfen, den sensorischen Kanal zu resetten.
👉 Passende Tools findest du im kostenlosen E-Book „Notfallkoffer bei innerer Unruhe“
Wenn du dich verloren fühlst
Manchmal spürst du, dass du einfach nur noch funktionierst. Du erledigst, was ansteht, triffst Entscheidungen, reagierst – aber innerlich bist du nicht wirklich da. Das Gefühl, dich selbst zu spüren, ist verschwunden.
Statt Präsenz, Klarheit und Ruhe besteht eine diffuse Leere, Entfremdung oder Orientierungslosigkeit.
Dieser Zustand entsteht oft nach Phasen starker Anspannung, emotionaler Belastung oder Reizüberflutung. Das Nervensystem versucht, sich zu schützen, indem es Teile der Wahrnehmung dämpft.
Nach außen wirkt das oft stabil, nach innen fühlt es sich hohl an. Du bist zwar da, aber nicht wirklich präsent.
In solchen Momenten geht es nicht darum, sofort „etwas zu tun“, sondern langsam wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Der Körper braucht Orientierung, die Sinne brauchen klare Signale, und das Ich braucht Rückmeldung: Ich bin hier. Ich bin sicher.
Was du spüren kannst
Dieses Empfinden kann nach Stress, Überforderung oder zu viel äußerer Reizung auftreten.
Was im Nervensystem passiert
Wenn zu viele Reize, Emotionen oder Gedanken gleichzeitig auf dich einwirken, verliert das Gehirn seine Orientierung zwischen Innen- und Außenwelt.
Die Verbindung zwischen Interozeption (Körperwahrnehmung) und Propriozeption (Raumwahrnehmung) wird geschwächt.
Das Nervensystem reagiert mit Desorientierung oder Teilabschaltung – einer Schutzstrategie, um Überforderung zu vermeiden.
In diesem Zustand fällt es schwer, Präsenz oder Zugehörigkeit zu spüren.
Wie du reagieren kannst
Hier helfen Reize, die dich wieder im Körper und im Raum verankern.
Bewegung, Bodenkontakt oder bewusstes Wahrnehmen deiner Umgebung senden Stabilitätssignale an das Gehirn.
Auch ruhige Selbstansprache oder rhythmische Bewegungen fördern das Gefühl von „Ich bin hier“.
👉 Passende Tools findest du im kostenlosen E-Book „Notfallkoffer bei innerer Unruhe“
Was du zu innerer Unruhe noch wissen solltest
Wenn nach einem Hoch die Unruhe bleibt
Unruhe kann aber auch nach Phasen entstehen, die sich zunächst positiv anfühlen: nach einer intensiven Projektphase, einem inspirierenden Vortrag oder einer gelungenen Herausforderung. In diesen Momenten ist das Belohnungssystem stark aktiv – Dopamin hält Motivation und Fokus hoch, Noradrenalin schärft die Aufmerksamkeit.
Wenn diese Phase endet – etwa weil ein Projekt abgeschlossen ist oder der äußere Druck nachlässt – fällt die innere Spannung nicht automatisch ab. Das Nervensystem bleibt zunächst auf „Antrieb“, obwohl kein Ziel mehr da ist. Der Körper sucht förmlich nach einem neuen Reiz, um die vorhandene Energie zu nutzen. Dieses Suchen wird häufig als innere Rastlosigkeit oder Leere erlebt.
Das ist Ausdruck der biologischen Gegenbewegung: Nach einer Phase hoher Aktivierung braucht das System Zeit und bewusste Unterstützung, um wieder in den Ruhezustand zurückzufinden. Erst wenn Körper und Geist die Signale erhalten, dass kein Handlungsdruck mehr besteht – etwa durch bewusste Pausen, Bewegung oder rhythmische Atmung – kann sich die innere Aktivierung allmählich lösen.
Warum Bewegung mehr ist als Auspowern
Viele Menschen spüren, dass Bewegung hilft, wenn die innere Unruhe nicht nachlässt. Doch der Effekt hat wenig damit zu tun, sich „abzureagieren“ oder auszupowern. Entscheidend ist, wie wir uns bewegen.
Nach Phasen hoher Aktivierung – ob durch Druck, Leistung oder inneres Getriebensein – ist der Körper noch voller Spannung. Muskeln, Kreislauf und Nervensystem sind noch im vollen Bereitschaftsmodus.
Bewegung bietet dem Körper einen Weg, diese gespeicherte Energie auf natürliche Weise abzubauen. Durch rhythmische Muskelarbeit wird das Stresshormon Adrenalin verbraucht, die Atmung vertieft sich und das Nervensystem beginnt, in die Regulation zurückzukehren.
Und was ist mit dem Cortisol?
Cortisol wirkt langsamer als Adrenalin und bleibt ohne aktive Regulation oft drei bis sechs Stunden im Körper erhöht. In dieser Zeit hält es den Organismus in erhöhter Wachsamkeit und verhindert, dass echte Erholung einsetzt. Moderate, rhythmische Bewegung unterstützt den Abbau dieses Überschusses. So kann der Spiegel allmählich sinken und der Körper in den Regenerationsmodus wechseln.
Das Ziel ist also nicht, sich zu erschöpfen, sondern den Übergang zu gestalten – von der Aktivierung zur Beruhigung. Besonders gleichmäßige Formen wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen unterstützen diesen Prozess, weil sie dem Körper ein klares, wiederkehrendes Muster geben. Das Herz schlägt schneller, aber im Rhythmus. Der Atem wird tiefer, aber ruhig.
So lernt das Nervensystem, dass Aktivität und Entspannung kein Widerspruch sind, sondern Teil derselben Bewegung.
Wenn Antrieb zur Gewohnheit wird
Gerade Menschen, die gewohnt sind, viel zu leisten, bleiben oft im Aktivitätsmodus, auch wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist. Der Körper hat gelernt, dass Anstrengung und Erfolg zusammengehören – und das Dopaminsystem bestätigt dieses Muster.
Mit jedem neuen Projekt entsteht wieder ein kleiner Schub von Vorfreude, Bedeutung und Zielorientierung. Das fühlt sich lebendig an, kann aber unbemerkt dazu führen, dass Pausen schwerfallen.
Wer immer in Bewegung bleibt, hält das Nervensystem in einem Zustand latenter Aktivierung. Die Momente des Innehaltens, des sich Freuens oder Genießens werden übersprungen. Dadurch fehlt die natürliche Rückmeldung, dass etwas vollendet ist. Das System bleibt auf der Suche nach dem nächsten Ziel – nicht aus Ehrgeiz allein, sondern weil der Körper gelernt hat, dass Aktivität Belohnung bedeutet.
Erst wenn bewusst Raum geschaffen wird, um Erfolge wahrzunehmen und den Übergang zu verlangsamen, kann das Nervensystem wirklich herunterfahren. Ruhe entsteht nicht von selbst, sondern durch das bewusste Erlauben des „Stillstands“.
Fazit: Selbstführung als Weg zur Regulation
Innere Unruhe ist kein einzelnes Symptom, sondern Ausdruck verschiedener Ungleichgewichte im Nervensystem. Sie kann körperlich, gedanklich, sensorisch oder existenziell erscheinen – aber sie folgt einem gemeinsamen Prinzip: Das System sucht nach Sicherheit.
Selbstführung bedeutet, diese Signale zu erkennen, zu deuten und bewusst auf die Ebene einzuwirken, auf der sie entstehen. Manchmal braucht es Bewegung, manchmal Stille, manchmal die bewusste Rückkehr in den Körper.
👉 Wenn du verstehen möchtest, wie du dein Nervensystem konkret unterstützen kannst, findest du im kostenlosen E-Book „Notfallkoffer bei innerer Unruhe“ passende Tools – einfach, alltagstauglich und neurobiologisch fundiert.

ResilienzImpulse
Lust auf Persönlichkeitsentwicklung mit Herz und wissenschaftlicher Grundlage? Dann bist du bei meinen beliebten ResilienzImpulsen genau richtig!

Marion Wandke
Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie Menschen in komplexen Lebensphasen innerlich klar und handlungsfähig bleiben können. Mich interessieren besonders die Wechselwirkungen zwischen Denken, Fühlen und Körperwahrnehmung – dort, wo Selbstregulation gefordert ist.
Ich arbeite heute als Resilienz-Coachin mit Fokus auf humanistischer Psychologie und Psychotherapie, Neurowissenschaften und Embodiment. Mein Schwerpunkt liegt auf Selbstführung und Selbstregulation als Schlüsselkompetenz. Ich bin überzeugt, dass echte innere Stärke aus Klarheit, Werteorientierung und Selbstführung entsteht.